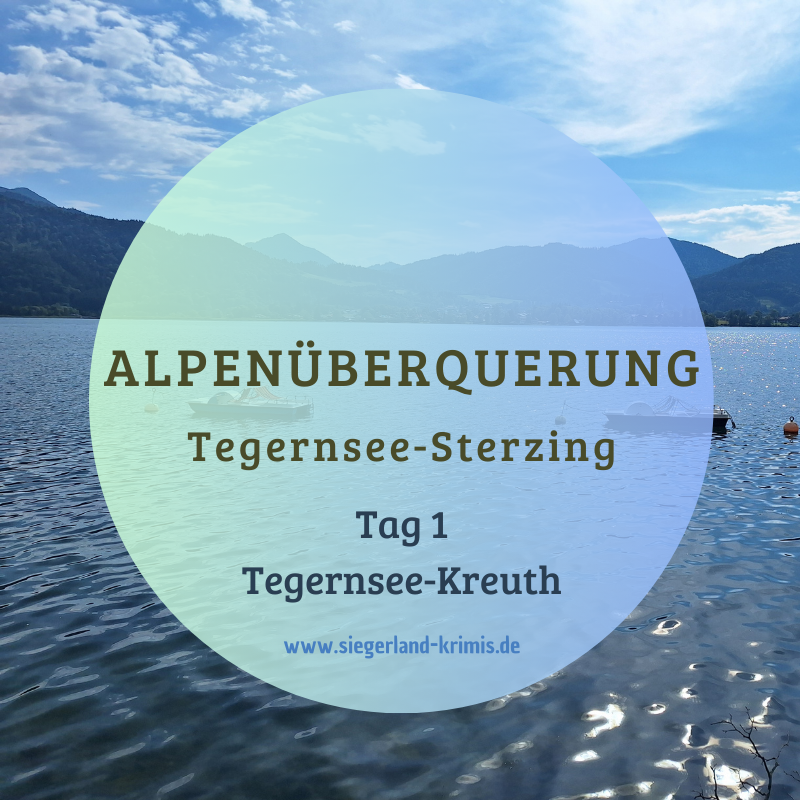Die „offizielle“ Alpenüberquerung vom Tegernsee in den bayrischen Voralpen über das Zillertal und den Alpenhauptkamm in Österreich bis nach Sterzing in Südtirol dauert sieben Tage.
Der Weg wird als „Alpenüberquerung für Jedermann“ bezeichnet und gilt als unschwierig. Man muss nicht klettern, es gibt quasi keine ausgesetzten Stellen, die Etappen sind bezüglich Länge und Höhenmetern überwiegend moderat.
Viele Teilstücke werden mit Bus, Bahn, Seilbahn oder Schiff überwunden, übernachtet wird überwiegend im Tal und wer will, kann sich sogar sein Gepäck von Unterkunft zu Unterkunft bringen lassen und mit leichtem Tagesgepäck wandern.
Es gibt die Alpenüberquerung Tegernsee-Sterzing auch als Komplettpaket mit Führung in Kleingruppen und Gepäcktransport.
Eine Alternative zum Hauptweg
Mir war schnell klar, dass ich so selbstständig und frei wie möglich wandern möchte.
Ich finde das Angebot solcher „Rundum-sorglos“-Pakete grundsätzlich gut, weil es eben viele unterschiedliche Ansprüche und Vorstellungen von so einer Wanderung gibt. Manche/r ist nicht fit genug, fühlt sich in einer Gruppe wohler, hat körperliche oder mentale Herausforderungen zu meistern und kann sich damit trotzdem einen großen Wunsch, vielleicht sogar einen Lebenstraum, erfüllen.
Aber meins ist das nicht.
Ich bin leidenschaftliche und überzeugte Alleinwanderin und für Gruppen wahrscheinlich ohnehin zu langsam. Wandern ist für mich Freiheit von Zwängen, von Angepasstsein, von den Erwartungen und Vorstellungen anderer. Ich bin auch gerne mit mir und meinen Gedanken alleine und genieße es, mich völlig auf den Moment einzulassen und meinen eigenen Weg in meinem Tempo zu gehen.
Auch auf dem Jakobsweg hat es mir viel Spaß gemacht, tagsüber alleine zu wandern und abends mit anderen zusammenzusitzen, zu quatschen und den Weg Revue passieren zu lassen. Es gab gute und offene Gespräche, die so vielleicht nur mit Fremden geführt werden, die man vermutlich nie wieder sieht.
Ich war also guter Dinge, dass es auf der Alpenüberquerung ähnlich wird.
Immerhin gibt es doch so viele und tolle Eindrücke auf so einer Wanderung!
Doch in diesem Punkt sollte ich mich irren, aber das könnt Ihr in einem anderen Beitrag lesen.
Etappenauswahl
Nach meinem Entschluss, die übliche Route vom Tegernsee nach Sterzing abzuwandeln, habe ich mir Wanderkarten und -bücher besorgt, viel im Netz und einer Facebook-Gruppe gestöbert und mich stundenlang durch die Wander-App Komoot geklickt.
Mein Anspruch war, so viel wie möglich zu laufen, ich wollte aber trotzdem die Option ÖPNV als Backup haben, falls es meinem Knie nicht besser ginge (falls Ihr den vorherigen Beitrag nicht gelesen habt: Ich laboriere schon seit Monaten an einer Überreizung des linken Knies nach einer Überlastung auf dem Mammutmarsch im Ruhrgebiet. Dafür kann allerdings der Mammutmarsch nichts …).
Außerdem wollte ich möglichst oft auf dem Berg übernachten und nicht jeden Abend ins Tal hinabsteigen müssen (nur um dann am nächsten Morgen mit Bus oder Bahn wieder nach oben zu fahren).
Es dauerte mehrere Tage, bis ich endlich meine Route zusammengestellt hatte.
Die Etappen sollten nicht zu lang sein (höchstens 20 km), nicht zu viele Höhenmeter haben (möglichst unter 1000 Hm) und in einem Ort bzw. auf einer Hütte enden. Oder zumindest an einer Bushaltestelle, um von dort zu meiner Unterkunft fahren zu können und morgens wieder zurück an die Ausstiegsstelle.
Die Unterkünfte
Als schwierig – und teuer! – stellte sich die Unterkunftssuche heraus.
Fast die gesamte Route verläuft durch touristisch gut erschlossenes Gebiet (es heißt sogar, dass die Route extra so gewählt wurde, um möglichst viele Gemeinden mit einzubeziehen), was zwar zu einer größeren Auswahl an Unterkünften führt, aber auch zu mitunter deutlich hohen Preisen.
Besonders am Tegernsee und am Achensee waren die Übernachtungspreise hoch, manche Zimmer wurden auch gar nicht für nur eine Nacht vermietet.
In diesem Jahr scheint die Unterkunftssuche sogar noch schwieriger zu sein, wie ich lese. Mir scheint, dass die kommerziellen Anbieter zunehmend mehr Betten belegen, sodass die Auswahl für Individualreisende noch schwieriger wird.
Mit meiner Unterkunftssuche begann ich im Januar und damit ein halbes Jahr im Voraus, doch viele günstige Hotels oder Pensionen waren zu dieser Zeit schon ausgebucht. Das hängt sicher auch mit den Kontigenten der professionellen Reiseanbieter zusammen.
Durch mehrere Absagen musste ich meine Streckenführung immer wieder abwandeln, doch Ende Februar waren dann alle Unterkünfte und die Bahntickets für Hin- und Rückreise gebucht und ich konnte mich entspannt zurücklehnen.
Meine Etappen
Meine eigene Alpenüberquerung Tegernsee-Sterzing unterschied sich teilweise von der offiziellen Strecke, manche Etappen waren wiederum identisch.
Durch meine eigene Wegführung war ich auch nicht die üblichen sieben Tage unterwegs, sondern neun.
Meine Etappen:
- Tag: Gmund am Tegernsee – Kreuth
- Tag: Kreuth – Gufferthütte
- Tag: Gufferthütte – Achenkirch
- Tag: Achenkirch – Erfurter Hütte (Maurach)
- Tag: Erfurter Hütte – Baumannwiesköpfl
- Tag: Baumannwiesköpfl – Hochfügen
- Tag: Hochfügen – Dominikushütte (Schlegeisspeicher)
- Tag: Dominikushütte – Kematen
- Tag: Kematen – Sterzing
Alles Weitere – Länge, Höhenmeter, Besonderheiten, Übernachtung – kommt dann ausführlich bei den einzelnen Etappen in eigenen Beiträgen.
Anreise
Streckenwanderungen haben den Nachteil, dass man, wenn man mit dem Auto anreist, am Ende wieder zurück zum Anfang muss.
Bei der Anreise mit der Bahn ist das zum Glück egal, ich kann vom Endpunkt aus direkt nach Hause fahren.
Wenn man nicht gerade auf den letzten Drücker bucht, kann man mit Spar- und Super-Sparpreisen relativ günstig mit der Bahn an- und wieder abreisen.
Die Anreise von Siegen über Frankfurt und München nach Tegernsee war im ICE ziemlich entspannt, auf der Rückreise aus Sterzing fuhr ich dann über Innsbruck, München und Frankfurt wieder retour.
Sonderbarerweise war ich sogar eine Stunde früher zuhause als geplant – so kann es also auch gehen!
Es gibt auch die Möglichkeit, mit dem Auto anzureisen, das Fahrzeug dann gegen Entgelt am Tegernsee zu parken und am Ende von Sterzing aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zurück zum Tegernsee zu fahren.
Von Sterzing nach Tegernsee fahren Züge, es soll aber auch einen Flixbus über den Brenner geben.
Da ich aber wirklich gerne Bahn fahre, kam für mich das Auto nicht infrage. Ich würde die Anreise mit der Bahn auch jederzeit empfehlen. So ärgerlich eine Verspätung auch ist: Nach so einem tollen Urlaub wollte ich definitiv nicht irgendwo im Stau stehen. Das hätte mir ziemlich viel Erholung und Entspannung genommen.
So geht es weiter
Am Ende der Reihe gebe ich noch ausführlichere Tipps zum Gepäck, zu Herausforderungen beim Wandern und erzähle auch, warum man diesen – und andere! – Wege auch gut als Frau alleine gehen kann – spezielle Tipps inklusive.
Aber jetzt lade ich dich erstmal ein, mich bei meiner Alpenüberquerung von Tegernsee nach Sterzing zu begleiten.